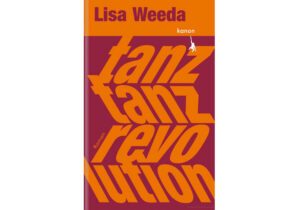Gerade hat Ludovico Einaudi sein atemberaubendes Album „Elements“ veröffentlicht – wir hatten das Glück, den berühmten Komponisten interviewen zu können.
DKB: Signore Einaudi, Sie haben ja bereits 1988 Filmmusik geschrieben. Was fasziniert Sie daran?
LE: Ja, das ist manchmal schon faszinierend. Besonders immer dann, wenn man eine gute und inspirierende Beziehung zu dem Regisseur aufbaut, mit dem man zusammenarbeitet. Wenn man die Freiheit hat, die es als Komponist braucht, wenn in gewisser Weise eine subtile Mischung aus Respekt für das Drehbuch und den Komponisten dazu kommt, dann kann man ganz unglaubliche Ergebnisse in der Kombination zwischen Musik und Bilder erzielen. Dies ist freilich ein Idealfall, der nach meiner Erfahrung leider eher selten geschieht. Doch wenn es dazu kommt, ist es außerordentlich lohnend.
DKB: Was benötigen Sie denn dafür inhaltlich bzw. als Inspirationsquelle? Das Drehbuch?
LE: Klar, das Drehbuch, das ist das eine. Eine Voraussetzung, gewiss. Doch meiner Meinung ist es so, dass erst dann wenn ich die Qualität der Bilder, die Fotografie sehe, die vielen kleinen Details der Schauspieler und der Bearbeitung persönlich sehe, bekomme ich eine Vorstellung davon, wie ich den richtigen Ton, die richtige Stimme und den richtigen Sound für die Musik finden kann.
DKB: Wie entstehen denn eigentlich Ihre Lieder oder besser gesagt Kompositionen?
LE: Ich arbeite, sagen wir einmal, auf eine recht unberechenbare Weise. Da gibt es eigentlich kein System, das vollständig organisiert wäre. Ich glaube, dass Kreativität und Inspiration die Grundlage des künstlerischen Schaffens darstellen und das Interesse an der Arbeit an einem musikalischen Werk lebendig halten. Andererseits weiß man jedoch nie, wann sich diese spontane schöpferische Fähigkeit, etwas zu schaffen, wieder einstellt. Ich fertige normalerweise Skizzen von fast allem an, was ich so mache, wenn ich auf Reisen bin oder etwas anderes mache. Und diese Ideenskizzen bewahre ich sorgfältig auf. Manchmal befinden sie sich auf meinem iPhone oder ich notiere sie auf einem Blatt Papier. Und dann kommt unweigerlich der Augenblick, wo man alle diese Ideen auf dem Tisch vor sich hat und man anfängt, sie mit größerer Aufmerksamkeit zu betrachten. Man denkt dann über die Möglichkeiten nach, was man damit machen könnte, und sieht das Potenzial, das sie für die Zukunft haben könnten.
DKB: Wie kam es denn eigentlich zu dem Song über Berlin? Gibt es da bei Ihnen eine besondere persönliche Nähe zu Berlin?
LE: Ja, dieser Song heißt „Berlin Song“ und er kam so zustande. Vor einigen Jahren befand ich mich für einige Wochen in einem wunderschönen, auf dem Gelände einer ehemaligen Rundfunkanstalt außerhalb von Berlin gelegenen Tonstudio, um ein Album aufzunehmen. An den Namen des Ortes kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, doch das Studio hieß Planet Roc. Normalerweise ist es so, dass wenn ich ein Album aufnehme, ich immer Platz für etwas lasse, das nicht geplant war. In diesem Fall saß ich da in diesem Studio am Piano, hatte eine Idee und fing zu improvisieren an. Ich nahm dann drei oder viermal dieses improvisierte Stück auf, hörte es mir an und sagte zu mir: „Gut, dies hier ist mein Geschenk an Berlin, einen Ort, den ich sehr liebe.“ Denn Berlin, müssen Sie wissen, ist meine Lieblingsstadt in Deutschland. Berlins Faszination rührt natürlich zum Teil auch von seiner dramatischen Geschichte her. Aber für mich gibt es da noch etwas anderes. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, spüre ich, dass, obwohl diese Stadt so voller Lebenslust, Inspiration und Ingredienzien ist, sie über eine weitere wunderbare Qualität verfügt, die ich sehr gerne mag, und das ist Stille. Berlin gibt mir eine Art innere Ruhe, die ich stets sehr genieße. Eigentlich ist das erstaunlich, denn Berlin ist eine so große Stadt. Aber sie hat diese unglaubliche Qualität, und ich glaube, das ist etwas Wertvolles.
DKB: Sie haben ja auch gelegentlich mit Jazz geliebäugelt. Wo liegt denn Ihrer Meinung nach die Trennlinie für Sie zwischen Klassik und Jazz?
LE: Ja, da gibt es tatsächlich in den letzten Jahre eine Trennlinie, weil sich die klassische Musik ab einem bestimmten Zeitpunkt in sich abgeschlossen hat. Ich glaube, wenn man in die Zeit Mozarts zurückgeht, wo er seine Kadenzen im Konzert improvisierte. Da gibt es durchaus Verbindungen beider Genres. Oder denken Sie an das Zeitalter des Barock und seine Verzierungen in der Musik, die von den Künstlern improvisiert wurden. Also, da gab es eine ganz starke Verbindung zu dem, was der Jazz in den letzten Jahren war. Deshalb denke ich, dass wir wieder dahin zurück müssen, um Trennlinien zwischen den musikalischen Grenzen zu vermeiden.
DKB: Der Kulturblog hatte bereits das Privileg Ihr exzellentes neues Album „Elements“ vorab zu höre, das ja ein zwölfteiliges Werk ist. Warum gibt es da zwölf Teile? Bedeutet diese Zahl etwas Besonderes für Sie, da ja jeder Teil der Suite auf die anderen Teile bezogen ist?
LE: Nun, für mich ist die Zahl der Teile wichtig, weil ich im Allgemeinen den Teil eines Albums zunächst gerne als eine Art Skizze anlege, die ich dann in drei, vier oder zwölf Teile untergliedere. Dies ist dann eine perfekte Kombination der Zahlen zwölf und vier. Auf diese Weise erhalte ich eine Art unsichtbare Ordnung, bei der jeweils alle drei Stücke etwas in einer anderen unsichtbaren Struktur passiert, in der sich alle vier Teile etwas anderes ergibt. Das ist schon eine Art Mysterium. Vielleicht ist das ja nur meine Theorie, aber die Zahlen helfen mir, die Dinge zu ordnen.
DKB: Seit wann ist es Ihnen wichtig, mit elektronischer Musik zu experimentieren?
LE: Ja, das war schon in meiner frühen Jugend der Fall. Damals in den 70ziger Jahren wurde noch nicht mit Computern experimentiert, sondern mit Bandmaschinen. Die großen Komponisten der Avantgarde der 60ziger Jahre wie Karlheinz Stockhausen oder Luciano Berio, der übrigens mein Lehrer war, zerschnitten die Tonbänder, auf denen sie ein Stück oder Klänge aufgenommen hatten, und setzten diese Schnipsel dann zu einer Komposition zusammen. Solche Experimente fanden Eingang auch in den Bereich der Popmusik. Man kann sie bei den Beatles oder Pink Floyd hören. Und dann kamen die Computer. Die waren am Anfang riesengroß. Man hatte einen Raum voller Computer, an denen Experten arbeiteten. Der Computer wurde aber dann im Laufe der Jahre immer kleiner, und man konnte mit ihm jetzt selbst das tun, was vorher nicht möglich war. Ich meine, es ist ein ganz normaler Bestandteil unseres Alltags, unserer Arbeit und Arbeitserfahrung, dass wir über diese Möglichkeiten verfügen. Und wenn ich da etwas erkunden möchte, dann nutze ich den Computer.
DKB: Ballettmusik gehört ebenfalls zu Ihren Kompositionen. Wie ist es da, sehen Sie dann die choreografischen Szenen vor sich, oder macht das kaum einen Unterschied zu anderen Werken?
LE: Für das Ballett habe ich gelegentlich gearbeitet, als ich 30 Jahre alt oder so war. Das ist also schon ziemlich lange her. Damals arbeitete ich eng mit den Choreographen zusammen, und wir diskutierten gemeinsam unsere Ideen. Für mich war das eine gute Möglichkeit, einmal mit meiner Musik und meiner Sprache in einem Kontext zu experimentieren, der nicht rein musikalisch war. Da konnte ich manche Dinge ausprobieren, die ich dann später für meine musikalischen Projekte gut nutzen konnte.
DKB: Ihr Großvater war ja auch Komponist und Dirigent. War ihre Karriere als Musiker womöglich vorherbestimmt?
LE: Nein, eigentlich nicht, weil mein Großvater hauptsächlich Operndirigent war. Komponiert hat er nur selten und wenn, dann war dies insbesondere Vokalmusik. Ich selbst habe meinen Großvater jedoch nie kennengelernt, denn er starb, bevor ich geboren wurde. Außerdem verließ er Italien vor dem Krieg und zog nach Australien, wo er eine Operngesellschaft gründete. Später wollte er dann nach Italien zurück, aber es war Krieg. Und damals war Australien sozusagen weiter entfernt als heute. Hinzu kam, dass die komplizierten Verhältnisse des Kriegs es ihm nicht möglich machten, nach Italien zurückzukehren.
DKB: Signore Einaudi, Sie haben Konzerte in allen großen und berühmten Konzerthäusern gespielt wie z.B. in der Royal Albert Hall. Gibt es vielleicht einen Ort, wo Sie noch nicht gespielt haben, dies aber mal gern tun möchten?
LE: Ja, wie Sie sagten, in Europa habe ich in den besten Konzertsälen gespielt und außerdem auch an magischen Ort, wie man Sie in Italien findet. Da habe ich in diesem Sommer in den antiken römischen Ruinen der Caraccala-Therme ein Konzert gegeben. Wenn Sie mich so fragen, ich würde vielleicht ganz gerne einmal in den großen amerikanischen Konzertsälen auftreten, was mir bislang leider nicht vergönnt war. Z.B. die Carnegie-Hall, da einmal zu spielen, das würde mir sehr gefallen.
DKB: Bitte ergänzen Sie einmal den folgenden Satz: „Es gibt etwas, ohne das ich nicht leben könnte, und das sind…“
LE: Ja, da würde ich sagen meine Kinder.
DKB: Welchen Beruf würden Sie in ihrem nächsten Leben wählen?
LE: In meinem nächsten Leben, ja das müsste etwas völlig anderes sein. Vielleicht Bauer oder Bäcker oder Gärtner.
DKB: Wen würden Sie gerne einmal eine Woche zu sich einladen?
LE: Ich würde gerne einen der großen Gärtner einladen. Ich glaube, die haben eine wunderschöne Arbeit. Das Leben draußen in der Natur. Großartig. Ihr Leben lang denken sie darüber nach und arbeiten daran, wie man einen schönen Garten baut. Ja, ich glaube, ich würde gerne einmal Gärtner einladen, einige Tage mit mir zu verbringen.
DKB: Signore Einaudi, herzlichen Dank für dieses Gespräch.