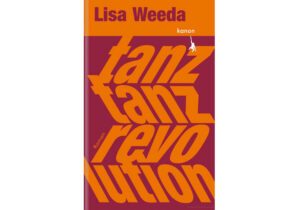DER KULTUR BLOG traf Deutschlands Top-Jazztrompeter Till Brönner am 08.01.2015 zu einem Gespräch.
DKB: Herr Brönner, Sie haben den Jazz als 13-Jähriger, also in einem sehr frühen Alter entdeckt. Wie kommt ein 13-Jähriger dazu, sich für die komplexe Musik eines Charlie Parkers zu begeistern statt für Alphaville, Talk, Talk oder Duran Duran wie seine Altersgenossen? Gab es da eine musikalische Vorprägung durch die Familie?
TB: Ich habe Jazz schon früher gehört. Speziell der Klang der Trompete hat mich in ihren Bann gezogen. Als ich über die Schulbigbands die Musik Glen Millers und Count Basies kennenlernte, hatte ich noch das Gefühl, dass ich beruflich irgendwann als klassischer Trompeter im Sinfonieorchester sitze.
Als mir ein älterer Bandkollege im Auto Charlie Parker vorspielen wollte, reifte in mir ziemlich schnell der Gedanke, dass das die Musik ist, die ich spielen möchte.
DKB: Sie haben einmal gesagt, dass Jazz eine Sprache ist, die jeder eigentlich lernen kann. Was meinen Sie damit?
TB: Jazz ist ein Vokabular. Ein Vokabular, mit dem man ähnlich umgeht wie mit einer Sprache.
Welche Bausteine, welche Worte, welche Vokabeln ich benutze, das ist Paukerei. In einer Sprache ist es ja auch so, je mehr wir von ihr umgeben sind, umso automatischer erlernen wir sie. So ist es auch in der Musik und im Jazz.
Was ich in der Sprache sagen möchte, das entscheide ich natürlich komplett selber. Ich eigne mir Improvisationsbausteine, die über bestimmte Harmonien gelegt werden, sowie Wirklichkeiten und stilistische Eigenarten, die mir gefallen, an. Je mehr ich davon ansammle, desto voller wird meine Schatztruhe und umso mehr Möglichkeiten habe ich. Der Idealfall sollte irgendwann sein, dass ich quasi blind in diese Kiste greifen kann und etwas finde, aus dem ich etwas mache.
DKB: Als Musiker haben Sie ja ganz verschiedene Dinge gemacht. Ihr Album „Chatting with Chet“ ist eine Hommage an Chet Baker; „Oceana“ mischt Bebob und Cool Jazz. „Rio“ unternimmt dagegen einen Ausflug in Bossa Nova und Latin America Jazz. Andererseits gibt es popnahe Experimente wie die Zusammenarbeit mit „No Angels“. Wie schafft man diesen Spagat, ohne dem Jazz untreu zu werden?
TB: Indem man ihm einfach nicht untreu wird. Untreu werden heißt ja nicht, dass man nicht auch wo anders mal reinriechen kann und sich vor allem vielleicht auch einmal die Bestätigung dafür holen sollte, dass der Jazz doch das ist, wo man zuhause ist.
Ich denke, die Musik verzeiht es generell und nimmt es nicht übel, wenn man ihr untreu wird. Das ist anders als im Leben. Das ist sensibler. Musik baut, egal um welche Stilrichtung es sich handelt, auf den gleichen Gesetzen auf. Im Jazz sind sie möglicherweise noch ein wenig komplexer, und in anderen Stilrichtungen sind sie vielleicht etwas, ich sage mal, rudimentärer, aber über die Intensität oder über den Wert dieser Musik sagt das überhaupt nichts aus.
DKB: Auf Ihrem neuen Album „The Movie Album“ spielen und singen Sie Filmmusik. Was hat Sie zu diesem Album inspiriert? Die Liebe zu den Filmen, deren Musik sie interpretieren, oder die Musik von Henry Mancini, Burt Bacharach, Ennio Morricone und anderen, die da versammelt sind?
TB: Es ist inspirierend, an einem Ort wie Hollywood zu leben, an dem die Filmmusik entstanden ist, und mitzubekommen, wie selbstverständlich diese Musik dort hergestellt und wahrgenommen wird und wie sie im Alltag auftaucht; wie kurz die Wege eigentlich zu großen Musikern und wirklichen Wirkungsstätten sind. Letztlich hat mich beides inspiriert oder alles zusammen. Als ich in Los Angeles mein Lager aufschlug, war für mich eigentlich von Anfang an vollkommen klar, dass das erste Album, mit dem ich mich zurückmelde, ein Filmmusikalbum sein muß.
DKB: Was hat Sie denn zu der Auswahl der Titel bewogen? Manche Komponisten aus der goldenen Zeit Hollywoods wie Dimitri Tiomkin, der ja die Musik für „High Noon“ geschrieben hat, sind nicht dabei. Mögen Sie keine Western?
TB: Doch, doch. Speziell Dimitri Tiomkin finde ich toll. Ein ganz, ganz großer Komponist.
Meine Lieblingsmusik ist die für den Film „Der alte Mann und das Meer“ auch verbunden mit meinem Lieblingsfilm. Das ist allerdings nichts, was sich auf der Trompete so wahnsinnig gut geeignet hätte.
DKB: Nun sind Sie ja Vater eines 11jährigen Sohnes, andererseits berufsbedingt ganz oft unterwegs. Wie schwer sind Familie und Beruf miteinander vereinbar?
TB: Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich komme aus einem Elternhaus, in dem beide Eltern fast durchgehend da waren, weil sie Lehrer waren. Nun ist es bei mir anders, weil ich reisender Künstler bin. Da sieht man seine Familie wesentlich seltener. Aber es hat dafür andere Qualitäten, man muss sich eben besser verabreden und planen, das kann sehr reizvoll sein.
DKB: Wenn wir einen Blick in Ihre CD oder Schallplattensammlung werfen dürften, was würden wir da finden? Ausschließlich Jazz?
TB: Nein, natürlich nicht ausschließlich Jazz. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich die Phase der Fremdhörerei und die große Monster-Sammel-Einkaufsphase hinter mir habe. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich anfange, meine eigene Plattensammlung wieder neu zu entdecken, um auch die Qualität heute noch einmal in einem anderen Kontext zu sehen, was vielleicht auch daran liegt, dass ich jetzt nicht mehr 25 bin, sondern auf die 45 zugehe.
DKB: Neben Ihrer Arbeit als Musiker lehren Sie derzeit auch an der Musikhochschule „Carl Maria von Weber“ in Dresden. Was reizt Sie an Ihrer Arbeit als Dozent?
TB: Anders als früher empfinde ich es heute als sehr inspirierend zu unterrichten. Ich kann mit meinen Studenten aufgrund der Tatsache, dass ich nach wie vor aktiver Musiker bin, aus einem ganz anderen Blickwinkel sprechen als ein Professor, der nicht mehr selbst aktiv ist. Ich empfinde es als ein großes Privileg davon erzählen zu können, jungen Studenten auch die Schattenseiten dieses Berufs aufzuzeigen. Wir haben es ja hier immerhin mit einer Berufsausbildung zu tun.
DKB: Der Schauspieler Klaus Maria Brandauer entspannt sich, indem er einen Tag mal nichts tut und sich der Langeweile hingibt, haben Sie auch ein Rezept, das Sie uns verraten möchten?
TB: Ich würde das unterschreiben, was er da sagt. Langeweile bzw. gerade das Nichtstun will wirklich gelernt sein. Man muss sich an das Nichtstun gewöhnen. Die Frage „Was mache ich denn jetzt mit dem angebrochenen Morgen?“, dies muss man auch als Therapie begreifen. In dem Augenblick, wo man zur Ruhe kommt, fällt man teilweise wirklich in sich zusammen, weil der Körper gewöhnt ist, dass ihm immer dauernd Adrenalin zugeschossen wird. In der Regel ist das ein Zeichen dafür überarbeitet zu sein. Ein bis zweimal die Woche bei dieser Art von Output ist so ein Tag, an dem man mal nichts tut, Medizin. Wunderbar.
DKB: Bei den vielen Dingen, die Sie machen, bleibt da eigentlich gelegentlich noch Zeit, um mal ein gutes Buch zu lesen und wenn ja, was haben Sie dann in letzter Zeit gelesen?
TB: Ich bin aufgrund meiner fotografischen Tätigkeit in letzter Zeit vor allem immer mit vielen Fachbüchern unterwegs. Es gibt natürlich Bücher. Aber ich bin wirklich jemand, der letztlich einfach doch ein Musiker ist, der über das Ohr funktioniert.
Auf Reisen kommt jedoch immer wieder ein gutes Buch zum Tragen. Das letzte, was ich gelesen habe, war „Das Leiden anderer betrachten“ von Susan Sonntag.
DKB: Wenn Sie sich mit drei Begriffen charakterisieren müssten, welche wären das?
TB: Perfektionistisch, genießerisch und manchmal ungerecht.
DKB: Ist es eigentlich notwendig, jeden Tag zu üben, um Höchstleistungen zu bringen? Wie sieht das mit dem Training aus?
TB: Ich muss täglich üben. Ich sage meinen Studenten oder auch Kindern, die Trompete spielen und zum Konzert kommen, immer als erstes: „Lieber jeden Tag fünf Minuten üben als drei Tage nichts und dann zwei Stunden am Stück. Beim Trompete spielen oder überhaupt beim System Blechblasinstrument geht es vor allem darum, das Spielen und Pausieren in der Balance zu halten. Man erhält sich so die „Betriebstemperatur“ und Flexibilität.
DKB: Die vielen Tourneen, Schallplattenaufnahmen, das ist ja alles eine Menge Stress. Machen Sie zusätzlich noch Fitnesstraining?
TB: Zur Zeit mache ich nicht so viel Fitnesstraining, wie ich es machen sollte. Yoga und Atmung helfen dabei, wieder zu sich selbst zu finden. Der Körper braucht Bewegung. Es muss nicht immer das typische Fitnesstraining sein. Spazierengehen, überhaupt Bewegung, das ist schon viel wert. Das Schlimmste ist, nichts tun.
DKB: Wenn Sie irgendetwas an Ihrem Beruf als Musiker ändern wollten, was wäre das?
TB: Ich fürchte, ich kann nicht so viel ändern, wie ich ändern wollte.
Was ich sozusagen im Traum gerne abstellen würde, wäre das Verhältnis von Reise zu Konzert. Anderthalb Stunden Konzert stehen manchmal in überhaupt keinem Verhältnis zum Aufwand des Reisens. Aber das lässt sich schwer abstellen. Man muss Kompromisse finden.
Ein guter Ansatz ist zum Beispiel, nicht immer nur für das Konzert irgendwo hin zu reisen, sondern sich noch einen zusätzlichen Tag zu gönnen, um sich die Stadt anzusehen. Denn eigentlich sehen wir außer Konzertsälen und Hotelzimmern gar nicht so viel.
DKB: Im Mainstream gibt es ja feste Regeln, wie „Radiomusik“ bezüglich Länge, Instrumentalanteil usw. aufgebaut sein sollen. Die Struktur wird so gewissermaßen normiert. Auf Ihrem Album „At the End of the Day“ interpretieren Sie Pop-Klassiker. Wie fühlt sich denn ein Jazzer dabei? Ist es der gleiche Spirit? Oder ist es wie bei einem Handwerker, der
Auftragskunst macht?
TB: Also Auftragskunst ist es nie, weil ich mich immer zwischen den Welten bewegt habe. Also das lupenreine Pop-Album, das gibt es von Till Brönner nicht.
DKB: Auch Miles Davis hat sich ja schon mal gerne zwischen den Welten bewegt…
TB: Ja, stimmt. Der hat allerdings auch nie ein lupenreines Pop-Album gemacht, sondern es gab glückliche Fügungen, die allerdings nie verhehlten, dass es sich um Miles Davis handelte. Sein wahrscheinlich poppigstes Album ist das, was noch posthum entstanden ist mit DJ Premier, dieses Doo-Bop-Album, in dem er Licks eingespielt hat. Diese sind im Nachhinein noch mal dazu gemixt worden, aber so genial, dass man das Gefühl hat, der könnte auch die ganze Zeit daneben gestanden haben.
DKB: Herr Brönner, wir haben im Vorfeld zu diesem Interview unsere Community auf Facebook gefragt, was sie gerne von Till Brönner erfahren möchte. Aus dem Feedback haben wir fünf Fragen herausgegriffen. Ich hoffe, Sie haben noch so viel Zeit für uns?
TB: Habe ich.
DKB: Daniela möchte gerne wissen, mit welchen Musikern Sie am liebsten zusammen gearbeitet haben.
TB: Das ist immer eine sehr schwierige Frage. Es gab sicherlich einige Schlüsselmomente in meinem Leben. Und dazu muss ich ganz sicherlich die Zusammenarbeit mit Hildegard Knef zählen, die über Jahre andauerte und für mich auch menschlich ganz bereichernde Aspekte gezeitigt hat. Und sicherlich auch meine allererste Platte, die ich überhaupt gemacht habe, mit Ray Brown, dem Bassisten von Oscar Peterson und frühen Ehemann von Ella Fitzgerald.
DKB: Aber Sie glauben nicht, dass der Jazz einmal ganz verschwindet aus der musikalischen Landschaft und dann so ein Mix übrig bleibt, wie das ja heute zum Teil schon der Fall ist?
TB: Ich glaube, man muss immer davon ausgehen, dass die Gefahr besteht, dass der Jazz verschwindet. Denn nur das ist der richtige Weg, um dafür zu sorgen, dass dies nicht passiert. Ich höre seit 15 Jahren immer den Satz: „Jazz ist ja schwer im Kommen.“ Ich kann das ehrlich gesagt nicht bestätigen. Er muss immer wieder gepflegt werden.
DKB: Heike möchte wissen, ob es vielleicht einmal ein Duett mit Chris Botti geben wird (Trompeter, der auch mit Sting gespielt hat, DKB).
TB: Das gibt es bereits, und zwar auf meiner Weihnachtsplatte „The Christmas Album“. Darauf ist ein Stück, das heißt „Notes on Snow“ und da spielen wir zusammen im Duo.
DKB: Liese fragt, wie man damit am besten umgeht, wenn man in der Öffentlichkeit steht und vielleicht auch einmal Kritik einstecken muss. Ist das schwierig?
TB: Mit Kritik umzugehen ist nichts, womit man auf die Welt kommt. Wenn man allerdings versteht, aus welchen Beweggründen Kritik entsteht, dann wird’s spannend. Und wenn man plötzlich, einen klaren Blick über die Jahre dafür entwickelt hat, welche Kritik berechtigt ist, dann bleibt man offen für sie, weil sie eigentlich bereichernd ist. Kritik ist mir mittlerweile nicht mehr so wichtig. Ich muss mir selber am nächsten sein. Dafür habe ich nur ein Leben.
DKB: Jakob Peter schreibt: „Lieber Till, kannst du dich an Baden-Baden erinnern, als du mit einem kleinen Jungen auf der Hoteltreppe Trompete gespielt hast und mir ein persönliches ‘Meet and Greet‘ geschenkt hast. Herzlichen Dank nochmal für den ganz besonderen Tag!“
TB: Ja, natürlich erinnere ich mich daran. Ich glaube, er hatte an dem Abend sogar noch seine Schwester dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Es muss Baden-Baden gewesen sein. Und er hatte einen sehr netten Vater dabei. Ich glaubte, die richtige Mischung aus Motivation und Förderung für seine Kinder zu spüren.
DKB: Und dann fragt noch Antonia, was Ihrer Meinung nach der Grund dafür ist, dass Sie als einer der wenigen deutschen Jazz-Musiker auch kommerziell erfolgreich sind.
TB: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich freue mich darüber natürlich. Insgesamt ginge es dem Jazz jedoch besser, wenn es mehr Gallionsfiguren gäbe. Es hat sich allerdings auch medial so viel verändert, dass es noch viel schwieriger als je zuvor geworden ist, Musik an den Mann zu bringen. Und Jazz erst recht. Die Medien-Slots sind einfach den Menschen vorbehalten, die ohnehin schon im Gerede sind. Es ist heutzutage offenbar einfacher, eine schlechte Kritik über jemand Bekanntes zu platzieren statt eine gute Kritik über jemand Unbekanntes, der es aber verdient hätte, an die Öffentlichkeit zu kommen. Ein Portrait in einer Tageszeitung hat früher dafür gesorgt, dass in der Regel am nächsten Tag ein Run auf die CD losging, weil man das Gefühl hatte, also wenn die „Süddeutsche“ das schreibt, dann muss da ja wohl etwas dran sein, dann will ich mit dabei sein. Das ist heute nicht mehr so.
DKB: Herr Brönner, herzlich Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch mit DER KULTUR BLOG!
TB. Ich danke Ihnen.
Foto: ©Ali-Kepenek